

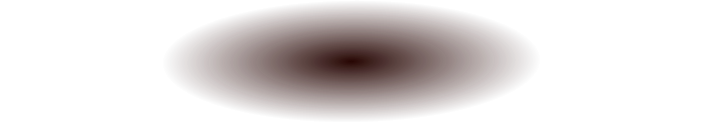
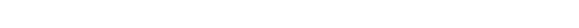
Husky Info‘s
|
Brand 45 | 3531 Waldhausen | Tel: +43(0) 664 / 116 41 62


Informationen zur Huskyzucht / Zuchtauswahl / Championzucht
Championzucht, ein Segen oder ein Fluch?
Wie würden Sie den Einfluss eines Champions auf seine Nachzucht einschätzen? Eines ist sicher, Rüden, die erfolgreich an vielen Ausstellungen teilnehmen und vielleicht sogar den einen oder anderen Titel einheimsen konnten, decken in der Regel mehr qualitätsvolle Hündinnen, als weniger hoch dekorierte Artgenossen. Das mag in erster Konsequenz zu einigen erfolgreichen Nachkommen und entsprechender Reputation führen. Trotzdem sind solche Verpaarungen kein Beweis dafür, dass Champions ihre Qualitäten besser über fünf bis zehn Generationen vererben als Rüden, die nur zwei- oder dreimal im Deckeinsatz waren. Viel größer ist jedoch die Gefahr, dass sich durch eine gezielte Championzucht bestimmte Erbdefekte stark verbreiten und es sogar bei beliebten und zahlenmäßig großen Rassen zu einer Inzuchtdepression mit all ihren negativen Folgen kommt. Wenn ausreichend Informationen zur Verfügung stehen, kann man die genetische Bedeutung eines Hundes theoretisch prozentual berechnen. Diesen Prozentsatz berechnet man, indem man die Weitergabe seiner Gene Von Generation zu Generation überprüft. Jedes Individuum erbt einen Chromosomensatz von seinen Eltern, die somit zu jeweils 50 Prozent beteiligt sind. Da die Elterntiere jeder Generation 50 Prozent beitragen, erscheint es nur logisch, dass 25 Prozent von den Großeltern und 12,5 Prozent von den Urgroßeltern stammen. Auch wenn das so ist, wissen Genetiker, dass es sich hierbei in der Praxis eher um Vermutungen als um sichere Aussagen handelt. Vererbung ist eben nicht einfach wie das Vermischen mehrerer Farbtöne in einem Eimer. Blau und Gelb muss noch lange nicht unbedingt Grün ergeben. Eine Championverpaarung garantiert keinesfalls zu 100 Prozent Champion- Nachwuchs. Solch ein Treffer ist denkbar, aber nicht berechenbar. Es gibt keine Garantie: Nochmals zur Verdeutlichung. Wenn ein Rüde einem Welpen einen Chromosomensatz weiter gibt, dann enthält dieser womöglich Erbinformationen beider Großeltern väterlicherseits. Das muss aber nicht so sein. Es gibt keine Garantie dafür, dass sich Veranlagungen über viele Generationen hinweg zu einem exakt berechenbaren Maß vererben. Es ist theoretisch sogar möglich. dass sich nur die Veranlagungen einer der beiden Großeltern vererben - auch wenn das in der Tat sehr selten ist. Geht man zehn Generationen weit zurück, würde der Anteil eines jeden der 1024 Vorfahren theoretisch etwas unter 0,1 Prozent liegen. Die Ahnentafel eines reinrassigen Hundes mit Papieren erwähnt durchschnittlich vielleicht 200 Namen. Einige dieser Namen tauchen immer wieder auf - in manchen Ahnentafeln sogar bis zu 50 Mal. Hierbei handelt es sich um wichtige Vererber, die einen Großteil der vererbten Veranlagungen mit in die Zucht eingebracht haben. Das kann förderlich sein, muss es aber nicht. Wenn Sie sich eine Ahnentafel vornehmen, können Sie den Prozentsatz dieser wiederholten Einkreuzungen ganz einfach berechnen, indem Sie die Häufigkeit des Auftretens eines bestimmten Vorfahren mit der entsprechenden Prozentzahl seines Anteils in den einzelnen Generationen multiplizieren und dann die einzelnen errechneten Prozentsätze miteinander addieren. Heterzygotie schafft Vitalität: Hunde haben somit zwei komplette Sätze des genetischen Bauplanes. Es ist von Vorteil, wenn die Sätze möglichst stark voneinander abweichen, also bei jedem doppelten Gen möglichst eines von jedem Elternteil für eine bestimmte Funktion vorgesehen ist. Man spricht hierbei von genetischer Variabilität, die auch als Heterozygotie bezeichnet wird. Heterozygotie ist eine wichtige Voraussetzung für Vitalität. Bei der Inzucht verhält sich das anders, Hierbei liegen an vielen Genorten exakt die gleichen Gene, was mit dem Fachbegriff Homozygotie bezeichnet wird. Das kann mitunter eine Beeinträchtigung bestimmter Funktionen zur Folge haben. Unter Umständen wird die Nachzucht hierdurch krankheitsanfälliger, unfruchtbarer oder weniger leistungsfähig. Im Prinzip kann jede Lebensfunktion geschädigt werden. Theoretisch ist sogar ein Aussterben der Rasse nie auszuschließen. Experten nennen dieses Phänomen Inzuchtdepression. Also ist bei enger Linienzucht immer ein großes Wissen des Züchter Vonnöten. Zucht bedeutet immer Wissen, aus Angst jedes Mal einen anderen Deckrüden verwenden und nie homozygote Welpen zu züchten ist nicht Zucht, sondern die bessere Art der Vermehrung! Die Gefahren der Inzucht: Inzucht birgt auch ein Risiko. Sie kann den Schutz vor kranken Allelen einschränken, die bei Heterozygotie meistens durch ein gesundes Allel abgedeckt werden. Somit ist bei heterozygoten Hunden das gesunde Allel dominant und das kranke verhält sich rezessiv. Im Falle der Homozygotie treffen häufig zwei kranke Allele aufeinander und verursachen eine Erbkrankheit, weil es kein gesundes Allel gibt, das diesen Effekt überlagern könnte. In der freien Wildbahn wird Inzucht naturgeben vermieden. Viele miteinander verwandte Tiere wenden sich vor der Geschlechtsreife voneinander ab. Das dient Vermeidung von Erbkrankheiten und somit der Arterhaltung. Gäbe es diesen Mechanismus nicht, wären sicherlich bereits viele Arten ausgestorben. So groß die Gefahren der Inzucht aber auch sein mögen. Ohne sie gäbe es keine Rassehunde. Inzucht gehört aber immer nur in die Hände von erfahrenen Züchtern. Inzucht muss übrigens nicht immer die direkte Verpaarung zweier miteinander verwandter Individuen sein. Auch der Einsatz eines bestimmten Zuchtrüden über mehrere Generationen kann zu Inzuchtwirkung führen, die Alleleverluste mit sich führen. Logisch, schließlich besteht die Nachzucht eines häufig eingesetzten Champions nicht selten aus Halbgeschwistern oder sogar aus Geschwistern. Der Inzuchtkoeffzient erhöht sich, wenn Hunde der ersten oder späteren Nachzuchtgenerationen miteinander verpaart werden. Die Folge hiervon? Inzuchtdepression und eine flächendeckende Verteilung der Gendefekte des Rüden - auch wenn er ein Champion ist. Also denken Sie daran, enge Linienzucht ist hervorragend für die Zucht, aber seien sie sich ihrer hohen Verantwortung bewusst. Die Defektgene: Genetiker gehen davon aus, dass jeder Hund fünf bis zehn Erbkrankheitsallele besitzt. Bei Hunden sind circa 400 defekte Gene bekannt. Bei Menschen übrigens mehrere tausend. Tragen nun zwei Hunde dasselbe Defektgen, tritt bei der Nachzucht eine Erbkrankheit auf. Innerhalb der Rassehundezucht kann sich der Prozentsatz von Defektgenen auf zehn bis 50 Prozent belaufen. Also besteht eine hohe bis sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich beim exzessiven Einsatz eines bestimmten Championrüdens, der gerade in Mode ist, die Möglichkeiten von Erbdefekten häufen. Umso seltener eine bestimmte Hunderasse ist, desto größer sind die züchterischen Probleme. Der Inzuchtkoeffizient steigt von Generation zu Generation, obwohl der Züchter gar keine bewusste Inzucht betreibt. Dasselbe Problem kann bei populäreren Rassen auftreten, wenn bei diesen die so genannte Championzucht betrieben wird. Obwohl es eigentlich genügend Hunde gibt, wollen alle den Top-Rüden für ihre Hündinnen haben. Das Ergebnis: Ein wachsender Inzuchtkoeffizient, obwohl es eigentlich genügend "Frischblut" gäbe. Darum bedenken Sie, es muss nicht immer ein Champion sein! Wichtig sind die Qualitäten des Hunde's. Und wenn Sie einen guten Rüden besitzen, denken Sie daran. Er muss nicht jede Hündin decken, nur weil es dementsprechende Anfragen gibt! Wir haben teilweise für unsere Rüden sehr hohe Deckanfragen. Meist mindestens 5-10 Deckanfragen im Monat. Trotzdem decken unsere Rüden nur ausgesuchte Hündinnen, die wertvoll für die Zucht und den Erhalt der Rasse Siberian Husky sind. Gerade als Deckrüdenbesitzer haben Sie eine sehr hohe Verantwortung! Die Rückzüchtung: Nicht minder gefährlich ist das Ganze bei seltenen Rassen. Kann die Welpenzahl zum Beispiel aufgrund mangelnder Absatzmöglichkeiten der Welpen nicht erhöht werden, bleibt auf Dauer nur eine Lösung, die Einkreuzung einer nah verwandten Rasse. Manchmal ist das rückzüchten die beste Basis, um irgendwann einen großen Schritt nach vorne zu machen. Keine Panik! Oft ist der Unterschied zwischen den rückgezüchteten Tieren und den reinrassigen schon nach vier Generationen nicht mehr zu sehen. Bei Bedarf kann derselbe Vorgang nochmals wiederholt werden. Die Selektion: Hundezucht würde ohne Selektion keinen Sinn machen. Allerdings wäre es schön, wenn hierbei nicht immer nur optische Aspekte, sondern viel häufiger auch die Gesundheit im Mittelpunkt stehen würde. Bei der Leistungszucht ist das meistens der Fall, schließlich will man Hunde züchten, die in einem bestimmten Einsatzgebiet überzeugen und da kann man keine Krankheiten gebrauchen. Trotzdem sollte selektives Vorgehen auch hier nicht übertrieben werden. Durch züchterische Selektion reduziert sich die Anzahl der Allele, allerdings werden hierbei auch wichtige Allele bewahrt. Zuchtwertschätzungen sind übrigens nicht anderes als eine durchaus sinnvolle Form selektiver Zucht und können die Qualität einer Rasse erheblich verbessern. Zurück zur Huskyzuchtinformation / Zuchtauswahl























